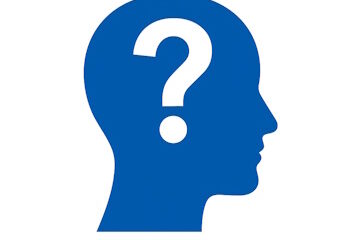Rechte, Gründe für Ablehnungen und praktische Handlungsschritte
Das Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO ist eines der wichtigsten Instrumente, um Transparenz über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu erhalten. Umso frustrierender ist es, wenn ein Unternehmen oder eine Behörde ein Auskunftsersuchen ganz oder teilweise ablehnt. Doch Betroffene sind einer solchen Entscheidung keinesfalls ausgeliefert. Dieser Beitrag zeigt, welche Ablehnungsgründe rechtlich zulässig sind und welche Schritte Betroffene unternehmen können.
1. Darf ein Auskunftsersuchen überhaupt abgelehnt werden?
Grundsätzlich müssen datenverarbeitende Stellen Auskunft erteilen. Ablehnungen sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. Typische zulässige Ablehnungsgründe sind etwa:
- Unklare Identität der anfragenden Person
Wenn das Unternehmen Zweifel daran hat, dass die Anfrage wirklich von der betroffenen Person stammt, darf es zusätzliche Identitätsnachweise verlangen oder die Auskunft verweigern, bis diese erbracht wurden. - Offensichtlich unbegründete oder exzessive Anfragen
Etwa wenn dieselbe Person sehr häufig identische Auskunftsbegehren stellt oder bewusst den Prozess stören möchte. - Beeinträchtigung von Rechten Dritter
Wenn die Auskunft personenbezogene Daten anderer Personen offenlegen würde, die nicht geschwärzt werden können. - Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse
Auch diese müssen geschützt werden; jedoch darf dies keine pauschale Ablehnung rechtfertigen. - Juristische Sonderregelungen
Zum Beispiel in Bezug auf strafrechtliche Ermittlungen oder Verarbeitungen durch Sicherheitsbehörden.
Wichtig: Nicht zulässig sind pauschale Ablehnungen, fehlende Reaktionen oder unvollständige Auskünfte ohne Begründung.
2. Was tun, wenn das Auskunftsersuchen abgelehnt wird?
Schritt 1: Begründung prüfen
Unternehmen müssen klar und verständlich darlegen, warum das Auskunftsersuchen abgelehnt wurde.
Fehlt die Begründung oder erscheint sie unlogisch, sollten Betroffene eine präzisierende Antwort anfordern.
Schritt 2: Identitätsnachweis nachreichen (falls gefordert)
Wenn Zweifel an der Identität bestehen, ist die Nachreichung eines geeigneten Nachweises oft der schnellste Weg, die Auskunft doch noch zu erhalten.
Wichtig: Nur notwendige Daten übermitteln – Ausweisdokumente notfalls schwärzen.
Schritt 3: Präzisierung des Auskunftsersuchens
Manchmal hilft eine Eingrenzung, etwa:
- bestimmter Zeitraum
- bestimmte Datenkategorien
- bestimmtes Produkt oder bestimmter Vertrag
Dies reduziert den Aufwand für die datenverarbeitende Stelle und kann eine erneute Ablehnung verhindern.
Schritt 4: Schriftliche Beschwerde an das Unternehmen richten
Ein sachlicher Hinweis auf die rechtliche Pflicht zur Auskunft und die DSGVO-Fristen (i. d. R. 1 Monat) zeigt oft Wirkung.
Viele Organisationen bessern nach, wenn sie auf mögliche Konsequenzen aufmerksam gemacht werden.
Schritt 5: Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
Wenn das Unternehmen nicht reagiert oder unberechtigt ablehnt, können Betroffene sich kostenfrei an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
Diese kann:
- das Unternehmen zur Auskunft verpflichten,
- Prüfungen veranlassen,
- oder Bußgelder verhängen.
Schritt 6: Rechtliche Schritte erwägen
In besonders hartnäckigen Fällen besteht die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage auf Auskunft.
Zudem können Betroffene unter Umständen Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO geltend machen, wenn ihnen ein messbarer Schaden entstanden ist.
3. Wie häufig sind unrechtmäßige Ablehnungen?
Praxis und Berichte der Aufsichtsbehörden zeigen, dass viele Ablehnungen auf Fehlinterpretationen oder organisatorischen Problemen beruhen – nicht auf rechtlich tragfähigen Gründen.
Daher lohnt es sich in vielen Fällen, hartnäckig zu bleiben und den Vorgang strukturiert zu verfolgen.
4. Tipps, um Ablehnungen von vornherein zu vermeiden
- Das Auskunftsersuchen präzise formulieren
- Frühzeitig Identitätsnachweise bereitstellen
- Fristen (1 Monat) im Auge behalten
- Sachlich kommunizieren und alle Schritte dokumentieren
Eine klare und höfliche Anfrage führt in den meisten Fällen zu einer schnelleren Bearbeitung.
Fazit
Eine Ablehnung eines Auskunftsersuchens ist selten endgültig gerechtfertigt. Betroffene haben starke Rechte und mehrere Eskalationswege – von der Nachreichung fehlender Angaben über behördliche Beschwerden bis hin zur Klage. Unternehmen sollten daher sorgfältig prüfen, ob eine Ablehnung wirklich vertretbar ist, und transparente Prozesse für den Umgang mit Auskunftsersuchen etablieren. Letztlich dient das Auskunftsrecht dem Ziel, Vertrauen in den Umgang mit persönlichen Daten zu schaffen – und dieses Vertrauen verdient konsequente Durchsetzung.